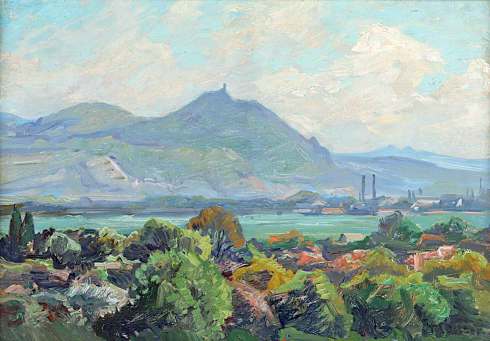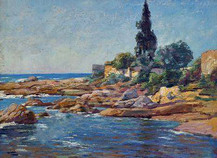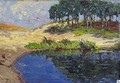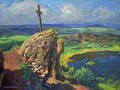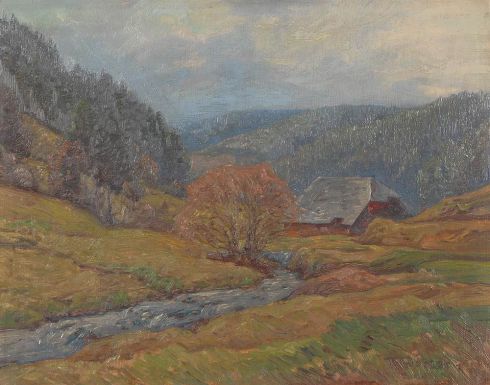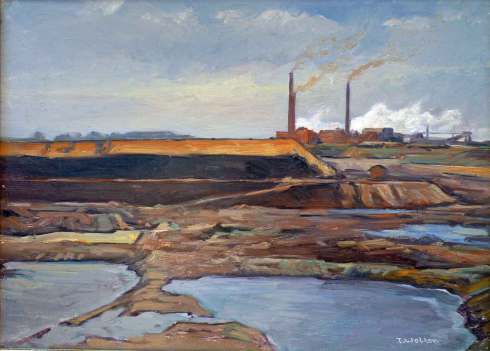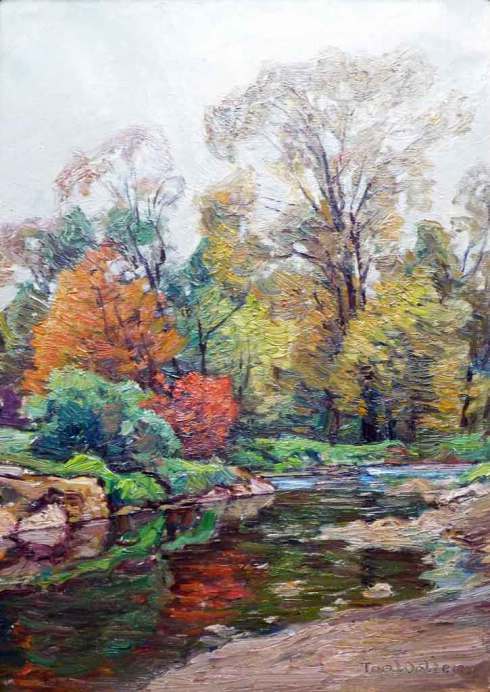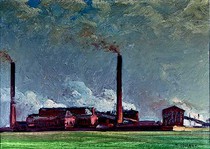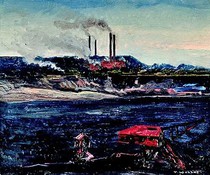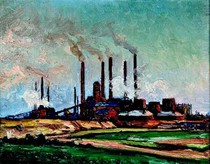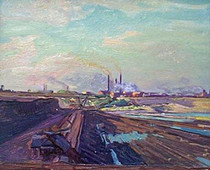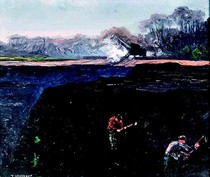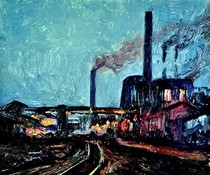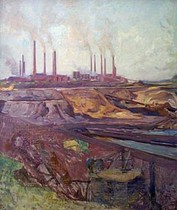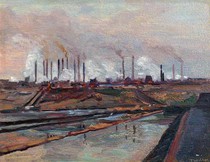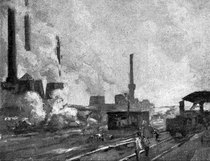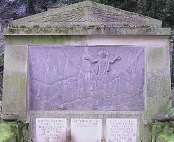Künstlerprofil Toni Wolter 1875-1929
1875 Anton (genannt Toni) Wolter erblickte am
20.09.1875 in Friesdorf zwischen Bonn und
Bad Godesberg das Licht der Welt. Die
Familie Wolter war eine alteingesessene
und sehr angesehene Bonner Familie, die
- weit verzweigt - durchaus einflußreiche
Persönlichkeiten aufwies. (Darunter die
Erzäbte im bayrischen Kloster Beuron,
einige Großindustrielle in den USA, Lehrer,
Pfarrer und Schulleiter/innen im Rheinland)
Tonis Vater, Lorenz Wolter, (1843-1905) war
der Sohn des Brauereibesitzers Anton Wolter
(1807-1883), der zusammen mit Tonis Onkel
Nicolaus Wolter 1855 von Bonn nach Fries-
dorf gezogen war, um dort Bier zu brauen.
Tonis Mutter Christine Wolter (1848-1905),
geborene Pützfeld, entstammte einer eher
einfachen Landarbeiterfamilie in Friesdorf. Toni Wolter wuchs die ersten
beiden Lebensjahre wohlbehütet in seinem Geburtshaus in der Annaberger
Straße unweit dem Haus seiner Großeltern (mütterlicherseits) in Friesdorf
auf.
1877 Umzug der Familie Wolter von Friesdorf nach Bad Godesberg. Tonis
Mutter Christine Wolter - kurz "Stine" genannt - , war eine resolute,
durchaus lebenskluge Frau. Sie übernahm in Godesberg die Gaststätte
"Zum Gambrinus" und machte das Lokal alsbald zu einem stadtbekannten
Treffpunkt für die Boheme, für Studenten ebenso wie für das (Bildungs-)
Bürgertum. Natürlich schenkte sie "Wolterbier" aus, das ihr Mann Lorenz
in der elterlichen Brauerei in Friesdorf braute und in den dortigen, braue-
reieigenen Felsenkellern kühlte. Die Wolters machten ein anerkannt
gutes Bier. Im Vorgebirge - überhalb von Alfter - bauten sie ihren eige-
nen Hopfen an und verarbeiteten Hopfen und Malz in einer eigenen,
eigens gebauten Malzmühle. Die Gaststätte "Zum Gambrinus" florierte
unter "Stines" Leitung. Schon bald konnte man sich ein größeres Wohn-
haus in der Winterstraße leisten. Der kleine Toni begleitete seinen Vater zur Arbeit. Während der Vater arbeitete, spielte Toni meist bei den Groß-
eltern oder im naheliegenden Wald am Venusberghang. Im Kindergarten
fiel schon früh sein zeichnerisches Talent auf.
Toni konnte bereits als Steppke erstaunlich genau Menschen, Tiere und
Bäume nach der Natur zeichnen. Bei Einladungen zu Familienfesten wurde
er geradezu als "Wunderkind" vorgeführt und vielleicht lag genau in dieser
frühkindlichen Erfahrung der Grund, warum Toni später nur ein berufliches
Ziel kannte: Er wollte unbedingt ein bildender Künstler werden.
1882 Toni wird in die Burgschule in Godesberg eingeschult. Er ist kein be-
sonders guter Schüler, hängt in Schreiben, Lesen und Rechnen den
anderen Kindern hinterher. Viel lieber durchstreift er die Gegend, er-
klettert jeden Felshügel und erkundet die Höhlen und Verstecke rund
um die Godesburg. Sein Vater veranlasst schließlich, dass er in`s
"Hubertinum" - eine Godesberger Privatschule - aufgenommen wird. Hier
soll er die notwendige Studienreife erhalten, um nach dem Willen seines
Vaters später einen anständigen Beruf - Pastor, Arzt, Lehrer oder Richter -
ergreifen zu können. Doch es kommt anders.
1885 Während der Schulferien, die der 10-jährige Toni bei einer seiner Tanten
in Moselweiß (heute Vallendar) verbringt, leitet ihn seine Cousine Lina
Frings an, das Aquarellieren zu erproben und bringt ihm die Grundzüge
dieser Maltechnik bei. Toni ist so fasziniert, dass er schon bald aus ei-
genem Antrieb "raus geht, um zunächst an einfachen, dann aber an
immer schwereren Motiven zu üben". Auch zuhause setzt er seine Übun-
gen fort. Darüber vergehen Jahre. Der Unterricht im Hubertinum ist öde,
Tonis schulische Leistungen werden auch durch Nachhilfe nicht wesentlich
besser. Einzig der Sport-, Musik- und Kunstunterricht interessieren ihn
wirklich. Beim Aquarellieren merkt er, dass es ihm einfach an der not-
wendigen handwerklichen Routine fehlt, um malerisch das auszudrücken,
was er ausdrücken will. "Die Farben wollen nicht so, wie ich es will" ver-
sucht er seinen Frust bei seiner Mutter los zu werden. Die bemerkt natür-
lich den trotzigen Unwillen ihres Sohnes, merkt aber auch, dass da offen-
sichtlich mehr als nur ein kleines Flämmchen in ihrem Sohn brennt.
Letzendlich ist sie es, die in ihrer klugen und bestimmten Art bei ihrem
Mann durchsetzt, dass ihr einziger Sohn, statt ein "Studierter" zu werden,
einen gestalterischen Beruf einschlagen darf. Allerdings, so postuliert der
Vater, wenn der Sohn schon nicht in seine Fußstapfen als Bierbrauer oder
in die seiner Mutter als Gastwirtin treten will und deren Geschäft fortführt,
so muß er doch einen "anständigen" Lehrberuf erlernen.
1889 Toni Wolter verläßt das Hubertinum und beginnt eine Lehre als Maler und
Anstreicher bei Meister Franz Le Roi in Bad Godesberg. Das hat zwar wenig
mit wirklicher Kunst zu tun, aber Toni lernt "von der Pike auf" mit Pinsel
und Farben, mit Verdünnen und Anmischen, mit Grundieren und streifen-
freiem, sauberem Farbauftrag umzugehen. Die drei Lehrjahre hält er
eisern durch, vielleicht auch deshalb, weil ihm ab und zu aufgetragen wird,
die ein oder andere Wandmalerei in den Treppenhäusern oder in der guten
Stube bei Kunden auszuführen. Nach drei Jahren ist es geschafft.
1892 Toni Wolter besteht seine Gesellenprüfung und wird "freigesprochen". Er
will mehr, geht nach Köln, um an der Abteilung für Kunstgewerbe der
"Gewerblichen Fachschule der Stadt Köln" ein Studium für Dekorations-
und Kirchenmalerei zu beginnen (Aus der Abteilung für Kunstgewerbe
entwickeln sich später die "Kölner Werkschulen"). Die Ernüchterung
ist groß: Toni behagt der schulische Drill, dem anfangs alle Studenten
unterliegen, überhaupt nicht. Er quittiert kurzerhand den Unterricht und
geht als 17-jähriger Geselle auf Wanderschaft (Walz). In rascher Folge
besucht er Berlin, Hannover, München und Konstanz. Von dort aus bricht
er in die Schweiz und nach Italien auf. Es ist nicht bekannt, bei welchen
Betrieben Toni gegen freie Kost, Logis und einem geringen Entgelt auf
der Walz gearbeitet hat. Er trifft in Italien auf einen freien Kunstmaler,
- wohl wie er ein Deutscher - "der ihm die Augen für die Schönheit der
Natur öffnet", mit ihm umherzieht, ihm die Toscana, Rom und Neapel
zeigt und zu jedem Monument, auf das sie stossen, eine passende Ge-
schichte zu erzählen weiß. Nach und nach erkennt Toni, dass Kunst,
Kultur und Bildung untrennbar zusammen gehören. Er saugt alles in sich
auf und ist glücklich, neben seinem Malerfreund sitzen, aquarellieren und
gleichzeitig dessen Worten lauschen zu können. Nach knapp einem
Jahr gemeinsamer Wanderschaft und Umherziehens trennen sich ihre
Wege wieder.
1894 Voller nachhaltiger Eindrücke kehrt Toni nach Hause zurück, da ihm
das Geld ausgeht. In Godesberg muß er nun selbst für seinen Lebens-
unterhalt sogen. Die Eltern helfen ihm, vermitteln ihm Aufträge zur
Schilderanfertigung für Geschäftshäuser und Werkstätten, für grafische
Arbeiten (Speisekarten, Weinkarten etc. ) sowie für die Renovierung und
künstlerische Ausmalungen von Decken und Wänden in Häusern des
Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreises.
Toni gestaltet unter anderem
die Gaststätte seiner Mutter, den
großen und kleinen Bewirtungs-
Saal des "Ännchens", die Treppen-
häuser der "Pferde"-Spedition
Düren sowie die Kontorwände der
angeschlossenen Kohlenhandlung.
In seinen freien Stunden malt er
Landschaften, Stillleben und Gen-
rebilder. Seine Zeichnungen und
Aquarellstudien sammelt er, um
sie gegebenenfalls später als Vor-
lagen für Auftragsarbeiten einset-
zen und nutzen zu können.
1897 Die Eltern, Lorenz und Elisabeth (Stine) Wolter verkaufen ihren Anteil an
der inzwischen ziemlich maroden Friesdorfer Brauerei sowie die gutge-
hende Gaststätte: "Zum Gambrinus" in Godesberg. Sie lösen ihren Haus-
halt komplett auf und ziehen zu Lorenz Schwester Anna Wolter nach
Vallendar (bei Koblenz). Anna Wolter betreibt dort ein Weiterbildungs-
institut für junge Frauen, und gibt unter anderem "Kochunterricht" und
"Hauswirtschaftslehre". Lorenz und seine Frau Elisabeth Wolter unter-
stützen sie mit ihrem profunden fachpraktischen Wissen.
Mit der Auflösung des Haushaltes in Bad Godesberg ist der Weg für Toni
Wolter frei: Er bewirbt sich an der Königlichen Kunstakademie zu
Düsseldorf und wird nach Vorlage seiner Künstlermappe zum Studium
in der Elementarklasse (Grundstudium) angenommen. Toni zieht nach
Düsseldorf um. Professor Ernst Röder (1819 -1915) und sein Assistent
Willy Spatz (1861-1931) betreuen die Elementarklasse. Und wieder hat
Toni zunächst nur öde zu "büffeln": Mit Bleistift, später auch mit Feder
und Tinte, sind tagein, tagaus klassische Gipsbüsten zu zeichnen. Als er
sich nach einem halben Jahr "grumelnd" bei Prof. Röder beschwert, deu-
tet ihm dieser an, dass die ganze "Plackerei" mit voller Absicht geschehe.
Man wolle und müsse in der Elementarklasse die weniger geeigneten
Studenten aussieben. "Entweder man ist von Natur aus Künstler, dann
setzt man sich auch durch, - oder man ist kein Künstler, dann gibt man
eben auf und wird "ausgesiebt". Toni ist das eine Lehre!
Nach einem weiteren halben Jahr stellt er im November 1898 den Antrag
auf eine Zwischenprüfung. Er besteht die Prüfung, ist damit "Eleve der
Königlichen Kunstakademie" und wird in die "Naturklasse" versetzt. Die
Aufgaben werden schwieriger, verlangen nun auch theoretisches Wissen
über den Charakter von Farben, von Licht, Perspektive, Proportionen, von
Flora und Fauna und von der menschlichen Anatomie.
1900 Zusammen mit einigen seiner Kommolitonen reist Toni Wolter nach Paris.
Dort findet gerade die Weltausstellung statt, in der das gesamte moderne
Wissen, neue Erkenntnisse der Naturwissenschaft, neue Erfindungen in der
Technik, neue Kunstströmungen etc. aufgearbeitet und dargestellt werden.
Der ideale Ort zum angewandten Lernen! Toni saugt alles in sich auf. Zu-
sammen mit seinen Kollegen studiert er die Meisterwerke im Louvre,
zeichnet, malt und aquarelliert die Vorlagen und vergisst auch nicht,
Alltagsszenen aus seinem täglichen Leben in Paris zu Papier bzw. auf die
Leinwand zu bringen. Monate vergehen, Toni lernt Land und Leute kennen.
Er ist wissbegierig, ist aufgeschlossen und reift heran. Zurückgekehrt nach
Düsseldorf wird er in die Klasse von Professor Eugen (Eugene) Dücker
(1841-1916) aufgenommen und darf endlich "Landschaftsmalerei" studieren.
Alles ist auf einmal anders. Bei Eugen Dücker gibt es keinerlei Zwang. Toni
Wolter hatte erwartet, dass der Meister ihm beibringt, wie man am besten
schöne Landschaften malt. Aber der Meister macht keinerlei Anstalten dazu.
Im Gegenteil. Er läßt seine Studenten in Ruhe. So müssen sie sich selbst
behelfen. Sie gehen raus in die Düsseldorfer Umgebung und malen vor Ort
das, was sie sehen. Und genau das hat Dücker bezweckt. Seine Schüler
sollen aus sich heraus nach ihren eigenen Sicht- und Malweisen malen. Nur
so kann nach seiner Überzeugung etwas Neues entstehen. Einzig die "Nach-
besprechungen" der entstandenen Arbeiten nimmt Dücker ernst. Und da
hagelt es häufig Kritik. Gerade die vermeintlich besonders "gelungenen"
Bilder nimmt er auseinander. "Du sollst nicht schön malen, Du sollst auch
nicht poetisch malen und Du sollst vor allem nicht das malen, wovon Du
glaubst, das andere es so sehen wollen. Sei Du selbst und entwickle
Deinen eigenen Stil!"
Toni Wolter braucht einige Zeit, um mit Dücker und seiner Malauffassung
klarzukommen. Dann aber verstehen sich die Beiden und offensichtlich
wird Toni in der Folgezeit sogar Dückers Lieblingsschüler. Er darf als
einziger zusammen mit Dücker an desssen Auftragarbeiten malen (So ist
beispielsweise belegt, dass der Meister mit seinem Schüler an einem
externen Riesenlandschaftsbild arbeitete, das die Schifferbörse in Duis-
burg-Ruhrort bei Dücker in Auftrag gab).
1902 Toni Wolter verläßt Düsseldorf für einige Monate, um als Privatschüler
des damals recht bekannten norwegischen Malers Fritz Thaulov (1847-1906)
die "nordische Naturauffassung" kennenzulernen. Thaulov beeinflußt
die Malweise seines Schülers und stellt ihm bei passender Gelegenheit
Eugen Bracht vor. Bracht ist mit Fritz Thaulov befreundet. Er hat im selben
Jahr eine Professur für Landschaftsmalerei an der Kunstakadmie Dresden
erhalten und zeigt sich an Toni Wolter als möglichen Meisterschüler und
Assistenten interessiert.
1904 Toni Wolter wird studentisches Mitglied in der Düsseldorfer Künstlervereini-
gung "Malkasten". Man trifft sich unter Kollegen im gleichlautenden Szene-
lokal "Malkasten", man feiert zusammen, verabredet sich untereinander und
schließt Freundschaften. Toni Wolters engere Freunde werden die Gebrüder
Hans und Joseph Kohlschein, Robert Seuffert, Walter Heimig, Richard Bloos,
Max Westfeld, Carl Plückebaum und Ernst Inden.
Berühmt (und wegen ihrer Freizügigkeit auch durchaus berüchtigt) waren
die Malkastenfeste, die als Kostümfeste jedesmal unter einem anderen
thematischen Motto standen und durch ihre fantasievollen künstlerischen
Dekorationen und ihre "stilbildende" Ausstattung glänzten. Toni Wolter
wirkte an einigen der zwischen 1904 und 1907 organisierten Themenfeste
mit. Maßgeblich hat er wohl die Ausstattung vom "Fest der schwarzen Tulpe"
geplant und mit seinen Malerfreunden umgesetzt. Auch an dem Festspiel:
"Im Reiche des Tanzes", das auf Idee und Konzept seines Freundes Robert
Seuffert beruhte, hat er mitgewirkt.
Bis 1908 blieb Toni Wolter studentisches Mitglied des "Malkastens" und auch
danach blieb er bis 1913 dem Malkasten als ordentliches Mitglied verbun-
den. Dies wohl auch deshalb, weil Toni Wolter im Malkasten seine spätere
Frau Else Schlesinger kennenlernte.
1907 Toni Wolter scheidet als Meisterschüler von Eugen Duecker aus der Kunst-
akademie Düsseldorf aus und geht zu weiteren Studien nach Dresden zu
Eugen Bracht. Er wird dessen Assistent und begleitet Bracht bei seinen
Studienreisen ins Elbsandsteingebirge, nach Prag und Böhmen. Wahr-
scheinlich nahm Toni Wolter über Eugen Bracht erstmals das Thema der
Industriemalerei als reizvolles, wenn damals auch noch sehr ungewöhn-
liches Motiv in der zeitgenössischen bildenden Kunst wahr. Toni Wolter
macht bei Eugen Bracht an der Kunstakademie Dresden seinen Ausbil-
dungsabschluß.
1907 Danach fährt er in seine Heimatstadt Bad Godes-
berg zurück, um dort noch im selben Jahr Else
Schlesinger zu heiraten. Else Schlesinger absol-
vierte in der 1904 zwischen Rüngsdorf und
Mehlem gegründeten "Rheinischen Obst- und
Gartenbauschule für Frauen" eine Ausbildung als
Landschaftsgärtnerin. Der Ehe entstammen drei
Kinder. Else Wolter, geb. Schlesinger kommt aus
einer begüterten deutsch-amerikanischen Indus-
triellenfamilie. Ihr Vater Adolf Schlesinger kam
1895 mit seiner Familie aus den USA nach
Deutschland zurück und zog nach Elses Heirat
mit Toni Wolter zunächst nach Düsseldorf. Die
Familie Schlesinger führte ein repräsentatives,
durchaus kunst- und kulturbeflissenes Haus und
waren u.a. mit den Familien Osthaus in Hagen,
Conen in Bonn, Dreyers in Bielefeld und Janssen
in Düsseldorf gut bekannt.
1902 kaufte sich Adolf Schlesinger in ein Stanz- und Dampfhammerwerk in
Werdohl ein. Er fördert die künstlerischen Ambitionen seines Schwieger-
sohns nach Kräften. Auf sein Anraten hin beteiligt Toni Wolter sich an einem
privaten Atelier für Theatermalerei in Düsseldorf ("Die Bühne") und erhält
dort ein festes Gehalt. Daneben vermittelt man ihm Privataufträge und
entsprechende Ausstellungsgelegenheiten. Schon bald hängen Toni Wolters
Landschaftsgemälde in Düsseldorfer und Bonner Kunstgalerien und finden
von dort ihren Weg in die Salons und Wohnzimmer des gutbürgerlichen
Mittelstandes. Schlesingers Werdohler Werk prosperiert in den Folge-
jahren, wird größer und größer bis es im Rahmen der Montanunion 1928
zusammen mit anderen Gesenkschmieden zur Hoesch- Schmiedag AG
verschmolzen wird.
1909 Die Beteiligung an dem Atelier für Theatermalerei "Die Bühne" wird für Toni
Wolter zu einem finanziellen Fiasko. Er verkauft seinen Anteil, erhält aber
nur einen Bruchteil dessen, was er privat hineingesteckt hat, wieder heraus.
Es reicht gerade, um sich in Düsseldorf in einer Fremdenpension einzu-
mieten und ein ebenfalls angemietetes kleines, eher karges Atelier zu be-
treiben. Zum Herbst des Jahres läßt sich das Paar - weitab von allen
Freunden und Bekannten - in der Eifel in der Nähe des Ortes Schlangen eine
Hütte zu bauen, um dorthin umzuziehen. Der Not gehorschend, laden die
Wolters regelmäßig Malerfreunde und Bekannte in ihre Hütte ein, um
durch Bettenvermietung zumindest eine geringe regelmäßige Einnahme zu
erzielen.
Toni Wolter sieht sich gezwungen, Bilder zu malen, die gut zu verkaufen sind, "schöne" Landschaften und markante, wiedererkennbare Stadtbilder nach dem Geschmack des Publikums. Erstmals malt und verkauft er nach eigenen Worten
das gleiche Motiv mehrmals. Der "Blick über den Rhein auf den Drachenfels"
wird ein besonderer Renner. Alleine von diesem Motiv sind aktuell vier leicht in
Größe und Ausschnitt variierende Fassungen bekannt.
1910 Toni Wolter zieht es mit seiner Frau
in den Süden. Sie verbringen den
Winter in San Margherita in Italien
und erkunden den Golf von Rapallo
und Portofino.
1911 Toni Wolter erkrankt in Rapallo an
Gelenkrheuma. Seine Genesung
zieht sich hin. Das Ehepaar Wolter
lernt in der deutschen Kolonie in
Rapallo u.a. Gerhard Hauptmann,
Siegfried und Cosima Wagner sowie
die Landschaftsmaler Hans Thoma
(1839 - 1924) und Gustav Schönleber (1851 - 1917) kennen. Beide unter-
richten als Professoren an der Kunstakademie Karlsruhe. Sie überreden die
Wolters, auf der Rückreise Station in Karlsruhe zu machen.
Von Rapallo aus reisen sie zunächst
über Rom, Neapel und Pompeji nach
Capri, wo Toni Wolter viele Anregun-
gen und farbenfrohe Vorskizzen für
seine späteren "Italienbilder" anfer-
tigt. Schließlich geht es per Schiff
von Neapel nach Genua zurück. Auf
dem Rückweg machen die Wolters
Station in Karlsruhe. Sie werden
durch ihre Malerfreunde in die Karls-
ruher Gesellschaft eingeführt. Toni
Wolter ist von den sich ihnen bietenden künstlerischen und gesellschaftlichen
Entwicklungsmöglichkeiten so fasziniert, dass er in der Westendstraße in
Karlsruhe ein großzügiges Atelier anmietet und mit seiner Frau eine große,
repräsentative Wohnung am Weinbrennerplatz bezieht.
1912 Von Karlsruhe aus bereist das Ehepaar Wolter in den Folgejahren zu
Studienzwecken die deutschen Mittelgebirge. Insbesondere die Eifel und der
Schwarzwald haben es ihnen angetan.
Toni Wolter nimmt erneut Kontakt zu seinen geistlichen Verwandten im
Kloster Beuron auf und malt an den Gemälden weiter, die Erzabt Placidus
Wolter bereits 1908 - noch vor seinem Tod - bei ihm in Auftrag gegeben
hatte. Toni wohnt mit seiner Frau für einige Monate im Koster.
Man versucht, ihn als Lehrer für die Beuroner Kunstschule unter Pater
Desiderius (bürgerlich: Peter Lenz 1832-1928) zu gewinnen. Er lehnt ab,
weil ihm die klösterliche Kunst in Beuron "sitlistisch zu romanisierend" und
wenig natürlich erschien. Zudem war seine Gesundheit ziemlich angeschla-
gen. Man hatte bereits 1911 einen schwerwiegenden Herzklappenfehler-
wohl infolge seiner wiederholten Gelenkrheuma-Anfälle, bei ihm diagnos-
tiziert.
1914 Toni Wolter wird aufgrund eines Attests von dem Kurarzt Dr. Franz Groedel
in Bad Nauheim "nicht kriegsverwendungsfähig" geschrieben. Seine vater-
ländische Pflicht erfüllt Wolter, in dem er als technischer Zeichner in der
zur Waffenschmiede umfunktionierten Werdohler Stanz- und Dampfham-
merwerken seines Schwiegervaters anheuert. Er beobachtet die Fabrika-
tionsabläufe, beobachtet die Arbeiter bei ihrer schweren Arbeit. Irgend-
wann beginnt er, schnelle, flüchtige Skizzen inmitten der von Dampfram-
men erzitternden Werkhalle, inmitten des Lärms, der Hitze und der
"magisch" glühenden, schweren Brammen anzufertigen. Im wird klar,
dass diese alles andere als natürlich-schöne Szenerie eine ganz eigene
Faszination und Ästhetik besitzt. Toni Wolter kann die so andersartige
Ästhetik allerdings mit seinen bisherigen malerischen Mitteln "nicht richtig
fassen". Als Landschaftsmaler eher mit Natur, Ruhe, Himmel und Erde,
Licht und Schatten, Luft und Wolken, mit detailreicher Nähe und horizon-
taler Weite konfrontiert, muss er sich nun mit den genau gegenteiligen
Elementen einer schwerindustriellen Produktion auseinandersetzen. Das
reizt ihn. Er fertigt in seiner Freizeit - basierend auf seinen Skizzen - erste
Farbstudien an, um malerische Lösungen für ein "Werkhallenbild" zu finden.
Schließlich - nachdem er sich seiner malerischen Ausdrucksmittel halbwegs
sicher ist - malt er ein großes Ölgemälde: "Das alte Dampfhammerwerk".
Damit hat er sich eine neue Motivgruppe - später vielfach als "Industrie-
malerei" bezeichnet - erschlossen. Gesundheitlich geht es ihm in Werdohl
nicht sehr gut. Seine Herzkrankheit ist nicht auskuriert. Er ist häufig krank,
was mit längeren Krankenhausaufenthalten verbunden ist. Schließlich wird
er von seiner Arbeit in Werdohl freigestellt und kehrt zu seiner Frau nach
Karlsruhe zurück.
1915 In Karlsruhe erblickt als erstes Kind eine Tochter das Licht der Welt. Toni
Wolter entschließt sich - aus gesundheitlichen Gründen und wegen der
unüberschaubaren Kriegslage - mit Frau und Tochter 1916 nach Hüfingen
(bei Donaueschingen) umzuziehen. Hüfingen war in Malerkreisen bekannt,
weil dort vor dem Zuzug der Familie eine Künstlerkolonie bestanden hatte.
Die Wolters führen - wohl mit finanzieller Unterstützung des Schwiegerva-
ters - ein großes Haus mit insgesamt vier Hausangestellten. Sie nehmen
an dem gesellschaftlichen Leben in der Stadt teil, finden letzendlich aber
keinen realen Anschluß.
1918 Die beiden Zwillingssöhne Gottfried und Wolfgang werden geboren. Zu
dieser Zeit herrscht eine Gippe-Epidemie, die bei Else Wolter zu einer
schweren Lungenentzündung führt. Die Zwillingsgeburt erfolgt unter großen
Komplikationen. Man sieht sich gezwungen, eine Frühgeburt einzuleiten.
Drei Tage später verstirbt Else Wolter, geb. Schlesinger im Wochenbett.
Sie wird nach Bad Godesberg überführt und am 2.11.1918 in dem Fa-
miliengrab der Wolters auf dem Godesberger Burgfriedhof begraben.
Zum Ende des ersten Weltkrieges steht Toni Wolter mit seinen drei Kin-
dern (und dem Hauspersonal) alleine da. Er entschließt sich, übergangs-
weise nach Karlsruhe zurückzuziehen, da er für Godesberg zunächst
keine Zuzugsgenehmigung erhält. Sein Geld hat Toni Wolter in Kriegsan-
leihen angelegt und es komplett verloren. Bei der Auflösung seines Haus-
haltes in Hüfingen kann er aber rund 30 seiner 60 bevorrateten Werke
verkaufen. Den Rest veräußert er in Karlsruhe, um die Familienunter-
kunft im Gasthof "Zur Kanne" in Untergrombach (bei Karlsruhe) zu bezahlen.
1919 Ein Artikel im "Badischen Beobachter" (Nr 228 vom 17.05.1919) über eine
eher private, nicht öffentliche Ausstellung seiner Werke im Saal des
Gasthofes "Zur Kanne" belegt, dass Toni Wolter eine Vielzahl von Skizzen
und Studien lokaler Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den "Blick zum
Tal" vom Michelsberg aus anfertigt, um diese auf "Bestellung" auszuarbeiten.
In wie weit seine Bemühungen fruchten und es tatsächlich zu entsprechen-
den Auftragsarbeiten kommt, ist nicht belegt.
Sein alter Schulkamerad Nicola Düren besorgt ihm schließlich die Zu-
zugsgenehmigung bei der damals durch die Engländer verwalteten Stadt
Bad Godesberg. Nach 30 Jahren kehrt Toni Wolter in seine Heimatstadt
zurück. Den Kontakt nach Bad Godesberg hatte er in dieser Zeit nie ver-
loren. Zwischendurch war er während seiner Studienzeit, während der
Studienreisen und in der anschließenden Zeit des Herumziehens immer
wieder zurückgekommen und hatte bei seinen Verwandten im Hotel-
Restaurant "Arndtruhe" Quartier genommen. Die "Arndtruhe" gehörte
der Familie Loevenich. Josef Loevenich hatte das Lokal als Schwiegersohn
von Minna Wallraff (Schwester von Lorenz Wolter und Tante von Toni) um
die Jahrhundertwende übernommen und es zu einem gutgehenden Hotel-
Restaurant mit einem angeschlossenen kleinen Ernst-Moritz-Arndt-Museum
ausgebaut.
1920 Toni Wolter erwirbt in Bad Godesberg in der Karl-Finkelnburg-Straße mit
den Mitteln, die sein Schwiegervater zugunsten der Enkelin Brigitta und
der Enkel Gottfried und Wolfgang angelegt hatte, ein Haus. An dieses Haus
baut er mit eigenen Mitteln ein größeres Atelier an und richtet sich darin ein.
Er geht wieder hinaus, um in "freier Licht und Luft" vor Ort zu malen. Seine
Landschaftsmotive findet er im unmittelbaren Umfeld von Bonn. Die lokalen
Motive kommen gut an und so verkaufen sich seine Gemälde wie von
selbst.
1921 Toni Wolter lernt auf einer Ausstellung in Wiesbaden Marthe Sauer kennen.
Sie ist 23 Jahre jünger als er, eine ausgebildete Musikpädagogin und
Malerin. Toni und Marthe werden ein Paar, sie verloben sich und heiraten
1922. Marthe stammt aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie in
Wiesbaden. Marthes Vater - August Sauer - ist ein bedeutender Architekt
und Baumeister. Ihr Onkel mütterlicherseits - Anton Raky - ist ein weltweit
tätiger Bohrunternehmer aus Salzgitter. Er verfügt über ein ausgedehntes
geschäftliches Beziehungsgeflecht und pflegt persönliche Verbindungen in
alle Welt. Seinem Patenkind Marthe und ihrem Mann bietet er großzügig an,
"etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen".
1922/ Irgendwann ist Toni Wolter zu Besuch bei einem Freund, der nahe einer der
1923 rheinischen Braunkohlengruben in einem alten Bauernhaus wohnt. Das
Haus soll abgerissen werden, Strom und Wasser sind bereits abgedreht
worden. Die beiden Freunde sitzen abends mit Blick auf ein entferntes
Brikettpresswerk mit angeschlossenem Kohle-Verstromungswerk am
Rande der riesigen Braunkohlengrube. Es beginnt zu dämmern und in dem
Maße, in dem die Grube vor ihnen immer dunkler wird, glühen die Lichter
in dem Verstromungswerk immer mehr auf. Aus den Schloten des riesigen
Werkes quillt massiger Rauch, der - von unten angestrahlt - ein quirliges
Farbspiel am Himmel verursacht.
Schlagartig fühlt Toni Wolter sich wieder an das Werdohler Stanz- und
Dampfhammerwerk seines Schwiegervaters und an die Skizzen erinnert,
die er damals in dem geschlossenen Werksgebäude gemacht hat.
Am nächsten Morgen skizziert er die Braunkohlengrube. Nun bietet sich
ein vollständig anderes Bild: In der sonnenbeschienenen Grube "quirlt" es:
Ein riesiger Schaufelbagger frißt sich durch die Erdschichten. Lange Förder-
bänder transportieren den Abraum vibrierend und quietschend ab. Andere
befördern die schwarze Kohle wie an einem mehrfach umgelenkten Faden
zu dem Werk, das im Hintergrund fast versonnen da liegt. Eher dünne
Rauchfahnen ziehen aus den Schornsteinen in den weitgehend blauen
Himmel.
Das Szenario läßt den Maler nicht mehr los. Er weiß, dass er an der künst-
lerischen Ästhetik dieser Motive einfach arbeiten muss. Das ist seine
Herausforderung, seine Arbeit! Zunächst noch versucht er die Kriterien
der über Jahre zu einer gewissen Perfektion gebrachten Landschaftsmalerei
auf seine neuen Motive und ihre Umgebungen zu übertragen. Dann aber
gibt er es auf, Plätze zu suchen, die im Vordergrund "schöne" Vegetation
zeigen. Nach und nach rückt er die offene Grube und die qualmenden
Schlote ins Zentrum seiner Gemälde.
Das kommt bei seiner bürgerlichen Klientel "nur be-
grenzt gut" an. Seine Bildverkäufe gehen zurück. Wer
will sich schon ein qualmendes Braunkohlewerk an die
Wand im Wohnzimmer hängen?
Dennoch, seine Bilder erregen Aufsehen. Man spricht
über sie und so ergeben sich im Laufe der Zeit neue
Kontakte. In dieser Situation tritt Anton Raky, Marthes
Taufpate, auf den Plan. Er gibt Toni Wolter den Auf-
trag, eines seiner Gewerke in Nienhagen zu malen
und macht ihn mit Dr. Paul Silverberg bekannt.
Silverberg ist Miteigner und Leiter des Braunkohle-
werkes Fortuna AG, das unter anderem den Strom
für die Stadt Köln liefert.
1923/ Toni Wolter bannt auftragsgemäß die Bohrtürme von Anton Raky in
1924 Nienhagen auf Leinwand. Er verbindet geschickt Industrie und Landschaft
miteinander und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Raky zeigt das Öl-
gemälde seinem Bekannten Paul Silverberg und vergisst nicht, hinzuzu-
fügen, dass Toni Wolter - der Maler - auch schon sehr beeindruckende
Gemälde im Rheinischen Braunkohlengebiet gemalt habe. Die will Paul
Silverberg natürlich sehen. Er beauftragt Toni Wolter, weitere "Braunkohle-
bilder" für ihn anzufertigen. Zudem stellt er ein Referenzschreiben für
Toni Wolter aus, in dem er bestätigt, dass dieser in seinem Auftrag tätig
sei und er mit den eindrucksvoll-repräsentativen Ergebnissen von Toni
Wolters Arbeit sehr zufrieden sei. Dieses Schreiben öffnet Toni Wolter
im Bereich der Industriemalerei alle Türen.
1925 Auf Vermittlung des Kurarztes Dr. Franz Groedel aus Bad Nauheim, mit
dem Toni Wolter seit 1911 persönlich befreundet war, erhielt er von dem
amerikanischen Großindustriellen Henry K. Janssen den Auftrag, dessen
Textilmaschinenfabrik in Pennsylvania (USA) zu malen. Henry Janssen war,
- wie Toni Wolter - Kurgast in der Klinik von Franz Groedel gewesen.
 Henry K. Janssen (mitte) mit seinen ebenfalls deutschstämmigen Geschäfts-partnern Ferdinand Thun und Gustav Oberländer (um 1925)
Henry K. Janssen (mitte) mit seinen ebenfalls deutschstämmigen Geschäfts-partnern Ferdinand Thun und Gustav Oberländer (um 1925)
Zusammen mit seinen beiden Ge-
schäftspartnern hatte Henry K. Janssen
die "Wyomissing Industries" in Reading,
Pennsylvania aufgebaut. Ein Unter-
nehmen, das zunächst Stoffe und Tex-
tilien zur Weiterverarbeitung durch
amerikanische Bekleidungsfirmen her-
stellte. Schon früh spezialisierte man
sich auf "Nylon" und andere Kunstfaser-
gewebe. Weltbedeutung erhielt der
Konzern durch Herstellung und Vertrieb
kompletter Nylonwirk- und Strick-
maschinen, die für elegante Damen-
strümpfe und Dessous, aber auch für
Militäruniformen, schussfeste Westen etc. gebraucht wurden. Sein Lebens-
werk wollte der umtriebige Unternehmer, ähnlich den deutschen "Industrie-
baronen" durch die Gründung eines Museums und einer bedeutenden
wissenschaftlich-kulturellen "Library", zudem durch großzügige Stiftungs-
zuwendungen und Forschungsstipendien für die Nachwelt gesichert sehen.
Toni Wolter reist mit seiner Frau Marthe im September 1925 in die USA.
Für beide ist es eine Studienreise, die über Düsseldorf nach Antwerpen und
von dort per Schiff nach New York führt. Er malt, sie fotographiert in New
York. Anschließend fahren die beide zu den "Wyomissing Industries" nach
Pennsylvania weiter. Hier findet er ein komplett eingerichtetes Maleratelier
und einen 25 m hohen, extra für ihn gebauten "Malerturm" vor, von dem er
aus das gesamte Gelände des Industriekomplexes überblicken kann.
In kurzer Zeit entstehen 15 kleine und mittelgroße Ölgemälde des Unter-
nehmens sowie einige reizvolle Landschaftsbilder, die Toni Wolter später
der Familie seines Auftragsgebers schenkt.
Zur Ausführung von drei großen, wandfüllenden Gemälden kommt es leider
nicht mehr, da zunächst die ungünstige Witterung (Schneefall) und dann
eine plötzliche Herzschwäche Toni Wolter an seiner weiteren Arbeit hindert.
Die Wolters kehren über Hamburg nach Deutschland zurück, wo man im
gesamten Familienkreis das Weihnachtsfest 1925 feiern kann.
1925/ Nach Toni Wolters Rückkehr aus den USA häuften sich seine Malaufträge
1926 aus der Industrie. Was dem Rheinische Braunkohlesyndikat unter ihrem
Vorsitzenden Paul Silverberg Recht war, wollten nun auch die Rheinbraun
AG, die IG Farben; das RWE, die Energiekombinate in Bitterfeld und Lausitz
sowie einige große Stadtwerke nun ebenfalls haben: Repräsentative
Ölgemälde ihrer Industrieanlagen, die man auf Messen, Kongressen, vor
allem aber in Geschäftsberichten veröffentlichen konnte. Toni Wolter hat
in den Folgejahren viel zu tun.
1928 Der Verein Deutscher Ingenieure organisiert in Essen seine Jahres-
tagung und richtet parallel dazu im Folkwang-Museum die große
Ausstellung: "Kunst und Technik" aus. Toni Wolter ist mit einigen seiner
"Braunkohlebilder" vertreten. Eigens zu diesem Event reicht er auch eine
zweite, größere Fassung seines Bildes von 1914: "Das alte Dampfham-
merwerk in Werdohl" ein. Vereinzelt greifen Kölner Galerien (u.a. der
Kunstsalon Abels) die Industriethematik auf und stellen einzelne Wolter-
Gemälde ihrem Kundenkreis vor. In den angesehenen "Westermanns
Monatshefte" (73. Jahrgang, Sept. 1928) erscheint ein Artikel von Prof.
Walter Bombe mit dem Titel: "Das Ruhrland in der Kunst unserer Zeit".
In diesem gibt er einen Überblick über die neue Gattung der "Industrie-
maler" ihrer Zeit. Toni Wolter ist exemplarisch mit zwei Ölgemälden
aus dem Bestand des Kunstsalons Hermann Abels vertreten.
Abb. links: Toni Wolter: Brikettfabrik der Abb. rechts: Toni Wolter: Industriebahnhof
IG Farben (Öl / Lw) Duisburg-Ruhrort (Öl / Lw)
In gewisser Weise hat Toni Wolter damit den Höhepunkt seiner male-
rischen Entwicklung erreicht. In der Bevölkerung gilt er weiterhin als
guter Landschaftsmaler, ist damit aber im lokalen Umfeld nur einer
von vielen. Teils wird er als "Bonner Maler", teils auch als "Eifelmaler"
einsortiert. Als frühe Industriemalerei ragen sicherlich seine "Braunkohle-
bilder" qualitativ und in gewisser Weise auch ausgesprochen originär aus
der deutschen Kunstszene heraus. Da er aber diese Gemälde fast aus-
schließlich im Firmenauftrag gemalt hat, bleiben die Motive in der breiten
Kunst- und Sammlerszene weitgehend unbekannt.
1929 Im Januar 1929 zieht Toni Wolter sich bei einem Besuch seiner Tochter
Brigitta in Köln eine schwere Erkältung zu, die sein ohnehin angegriffenes
Herz weiter belastet. Er sucht in einer privaten Reha-Klinik in Blankenheim
an der Ahr Linderung und Erholung.
Hier entstehen Toni Wolters letzte Zeich-
nungen. Als sich sein Leiden nicht
bessert, wird er in das Krankenhaus
Rüngsdorf (bei Godesberg) verlegt.
Am 11.04.1929 verstirbt Toni Wolter,
knapp 54-jährig, an den Folgen einer
Nierenbeckenentzündung. Er wird in
dem Familiengrab der Wolters auf dem
Burgfriedhof in Bad Godesberg beige-
setzt.
1975 Anläßlich des 100. Geburtstages von
Toni Wolter fertigt der Bildhauer Alfons
Biermann in den Werkstätten der Abtei
Maria Laach eine Relieftafel an, die in das
Grabmal des Künstlers eingefügt wird.
Jesus wacht mit ausgebreiteten Händen
über die rheinische Heimat Toni Wolters.
Zu erkennen ist u.a. die Kontur der Godes-
burg und des Drachenfelses. Als umtrie-
bigert Landschafts- und "Industriemaler"
blieb Toni Wolter lebenslang seiner Heimat
verbunden.
Abb. rechts: Detail aus der Grabplatte des
Familiengrabes Wolter mit Motivzitaten aus
Toni Wolters Landschaftsgemälden.
Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau
hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.