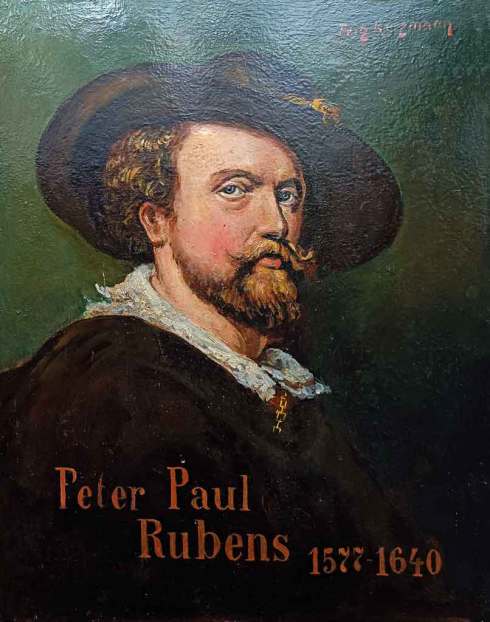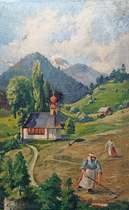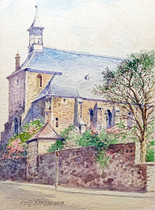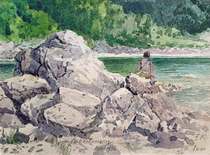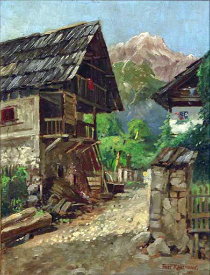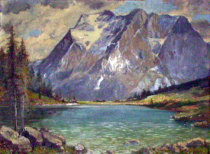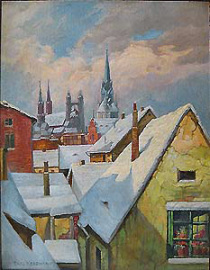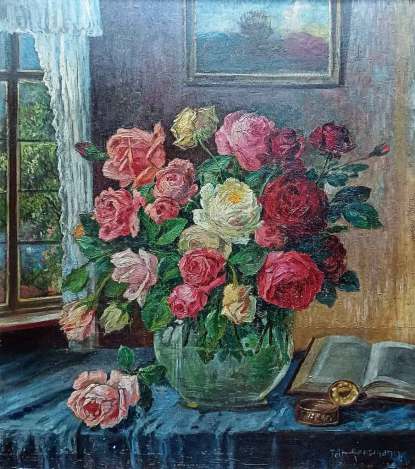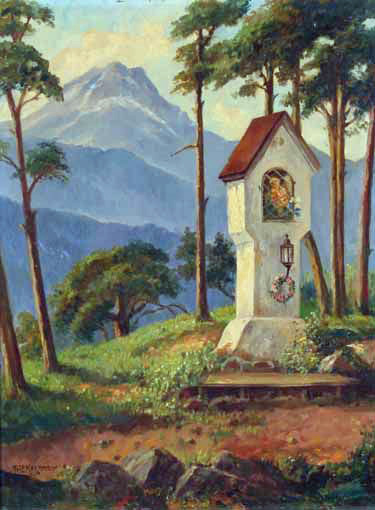Fritz (Gottfried) Kerzmann (1872 -1949)
1872 Der Bonner Maler, Moritaten-, Kon-
zert- und Opernsänger Gottfried -
genannt Fritz - Kerzmann erblickt
am 7.Juli 1872 in Bad Godesberg
das Licht der Welt.
Sein Vater Johann Peter Kerzmann ist
ein gelernter Schreiner und Tischler.
Seine Mutter Gertrud Kerzmann
stammt aus der Familie Hartmond in
Köln / Frechen.
Die Familie Kerzmann betreibt in der
Bad Godesberger Dorfstraße (heute
Turmstraße) ein Schreinergeschäft.
Natürlich möchte der Vater, dass
sein Sohn später einmal in das
Schreinergeschäft einsteigt. Schon
früh nimmt er den kleinen Fritz "auf
Montage" zu seinen Baustellen mit.
Doch Fritz' Begeisterung hält sich in
Grenzen. Die handwerkliche Tätig-
keit liegt ihm nicht so recht. Viel interessanter findet er das bunte Trei-
ben des eher großbürgerlichen Kurpublikums im nahen Kurpark. Er mag
es, den eleganten Herren und Damen zuzusehen, die dort lustwandeln,
nachmittags ihr Heilwässerchen aus der "Draitsch-Quelle" trinken, in's
Badehaus zum Schwimmen gehen und sich anschließend am Kurhaus
treffen, um dem dort aufspielenden Kurorchester zu lauschen.
1879 Fritz Kerzmann wird in die Burg-
schule in Godesberg eingeschult,
die zum damaligen Zeitpunkt drei
Volksschulklassen umfasst. Die
Kinder der ersten, zweiten und
dritten Klasse werden gemeinsam
unterrichtet.
Aus der gemeinsamen Schulzeit
resultiert eine enge Freundschaft,
die Fritz Kerzmann mit dem spä-
teren Bonner "Industriemaler"
Toni Wolter (1875-1929) verbindet. Während Toni Wolters Leben in der
Folgezeit verhältnismäßig umtriebig verläuft, bleibt Fritz Kerzmann "zu-
nächst der heimatlichen Scholle" treu.
um Irgendwann - wahrscheinlich schon als 13- oder 14-jähriger Bub - erlebt
1885 Fritz Kerzmann ein Schlüsselerlebnis, das seinen weiteren Lebensweg
prägen wird. Er wird von dem damaligen Leiter des Kurorchesters, der
wohl von einem Lehrer der Burgschule auf Fritz Kerzmanns besondere
Sangeskünste aufmerksam gemacht wurde, auf die Bühne gebeten und
darf - coram publicum - einige Volkslieder vortragen. Das kommt an. Er
hat eine gute Stimme. Wer es genau war, der ihm geraten hat, ein Pot-
pourri gängiger Melodien einzuüben, ist nicht überliefert. Vielleicht waren
es die trinkfesten Studenten im "Aennchen" gewesen, von denen er
einige ihrer launigen "Moritatengesänge" übernommen hat, vielleicht
waren's auch andere - jedenfalls wird der junge Fritz Kerzmann so etwas
wie ein früher Schlagersänger. Er hat Erfolg, erhält Applaus und Aner-
kennung (und erste Trinkgelder).
1892 Fritz Kerzmann tritt nun häufiger als "Moritatensänger" mit einem eige-
nem Liederprogramm im Bonner Umfeld auf. Mit den verdienten Gagen
finanziert er sich eine professionelle Gesangsausbildung zum Konzert-
und Opernsänger. Entdeckt wird er von dem Bonner Kammersänger
Karl Mayer, der ihn nach einer entsprechenden Vorprüfung in die Opern-
und Gesangsschule Köln zu Prof. Richard Schulz-Dornburg vermittelt.
Es folgt ein vierjähriges Fachstudium für Oper und Konzert. Seine
Lehrer dort sind: Gesang: Dr. Oscar Kaiser: Schauspiel und Dramatik:
Prof. Dr. Kipper; Musikwissenschaft: Wilhelm Rinkens; Klavier- und
Partienstudium: Wilhelm Muehldorfer. Stolz präsentiert Fritz Kerzmann
im Freundeskreis seine Visitenkarte, die ihn als gelernten Konzert- und
Opernsäger mit Spezialisierung auf den "Robert Schumann Liederkreis"
ausweist. Er tritt nun häufiger in Matinees und Soirees des gebildeten
Bonner Bürgertums auf und eignet sich nach und nach auch den "gesell-
schaftlichen Schliff" an. Als Künstler behandelt und entsprechend
"hoffiert" zu werden, schmeichelt ihm. Er lernt seine spätere Frau,
Gertrud Klockenbusch kennen. Sie stammt "aus gutem Hause" und ist -
wie er - in Bad Godesberg aufgewachsen. Nicht ganz zwei Jahre jünger,
wird sie Gerda oder auch Gerta gerufen.
1998 Die beiden heiraten am 15.08.1898 in Bad Godesberg. Aus Gertrud
Klockenbusch wird Frau Gottfried Kerzmann.
Fritz Kerzmann verdient das Geld zum Lebensunterhalt für sich und
seine Frau hauptsächlich durch Engagements als Konzert- und Moritaten-
sänger.
Da er zudem auch ganz passabel zeichnen und malen kann, beschließt
er, diese Befähigung ebenfalls weiter auszubauen. Wo und bei wem er in
der Folgezeit Privatunterricht nimmt, ist nicht bekannt. Er könnte even-
tuell einer der ersten Schüler in der privaten Malschule von Carl Nonn
gewesen sein, die dieser in seinem Atelierhaus in der Niebuhrstraße 14
in Bonn eingerichtet hatte und wenig später auch offiziell (ab 1905)
betrieb. Möglicherweise hat er sich seine Malkunst aber auch auto-
didaktisch selbst beigebracht. Genügend Anschauungsmaterial hat er in
Hülle und Fülle in den Salons seiner Kundschaft "vor Augen", wenn er
dort in seiner Eigenschaft als Sänger auftritt. Zudem läßt sich perfekt
über den Stil der zeitgenössischen Malerei und die Sujets der bildenden
Kunst in solchen Veranstaltungen "parlieren". Jedenfalls merkt Fritz
Kerzmann schnell, was seiner Kundschaft gefällt: "Heimatbilder" stehen
hoch im Kurs.
ab Fritz Kerzmann malt - dem Zeit-
1900 geist entsprechend - mehrere,
stilistisch eng an die "Rheinro-
mantik" angelehnte - Ansichten
von Rhein und Siebengebirge.
Natürlich dient ihm auch die
heimische Godesburg und andere
Baudenkmäler - wie das "Hoch-
kreuz" zwischen Godesberg und
Bonn mehrfach als Motiv.
Die Ölgemälde sind ganz im na-
turalistischem Stil der Eifelmaler
rund um Fritz von Wille sowie der
Düsseldorfer Landschaftsmaler
gehalten. Tatsächlich stehen seine
Ölbilder denen der Düsseldorfer
Akademiemaler in punkto Qualität
in keiner Weise nach.
Auch seine Befähigung, "stimmige"
Portraits zu malen, spricht sich in
den Salons seiner Kunden herum
und führt zu weiteren Aufträgen
aus der gehobenen Godesberger
Bürgerschaft.
Seine hübsche, elegante Ehefrau
steht ihrem Fritz zeitlebens regel-
mässig für Portraitstudien - später
auch als Staffage-Figur in seinen
Landschaftsgemälden - Modell.
Portraitmalerei
Fritz Kerzmann: Portraitbildnisse seiner Ehefrau Gertrud Kerzmann
links: 1920; rechts: 1940
1905 Fritz findet sein erstes Engagement als Bariton-Sänger und Schauspieler
am Stadttheater von Essen. Nun beginnt eine intensive künstlerische
"Wanderzeit". Seine Frau begleitet ihn.
Nach seinem Engagement in Essen (1905-1907) geht er für
eine Spielzeit nach Colmar in den Elsass, dann ans Stadttheater von
Augsburg und schließlich (von 1909-1912) an das Stadttheater von
Danzig. Von dort wechselt er an das Theater in Wuppertal-Barmen
(1912- 1914), kehrt aber (1914-1918) nach Danzig zurück. Nach und
nach erarbeitet er sich ein festes Repertoire als Bariton. Er singt den
Wolfram im "Tannhäuser", den Rigoletto, den Renato im "Maskenball"
von Verdi, den Alfio in "Cavalleria rusticana", den Sharpless in "Madame
Buttterfly", den Faninal im "Rosenkavalier", den Papageno in der
"Zauberflöte" und den Ottokar im "Freischütz". Damit gastiert er zwi-
schendurch auch an anderen Bühnen in Deutschland, so auch in
München. Seine Engagements sind allerdings zeitlich begrenzt und seine
Gagen als Repertoire-Sänger nicht so hoch, dass er davon alleine leben
könnte. Er ist auf Nebenverdienste angewiesen, verdingt sich vor allem
in seiner Zeit in München als Gesangslehrer und "tingelt" als "Moritaten-
sänger" in Kneipen und auf bayrischen Kleinkunstbühnen herum. Da-
neben ist die Ölmalerei für ihn eine sichere Einnahmequelle.
Dass Fritz Kerzmann seine Male-
rei mit entsprechender Profession
betreibt, lässt sich schon aus der
Tatsache ablesen, dass es ihn
immer wieder zu Studienzwecken
nach Grainau in die Alpen zieht,
um vor Ort - wie viele seiner
Künstlerkollegen - in freier Natur
alpine Hochgebirgslandschaften
auf Leinwand zu bannen. In Ober-
grainau bei Garmisch-Parten-
kirchen bewohnt Fritz Kerzmann stets ein "Tusculum mit kleinem
Gärtchen", wie er es nennt, in dem er walten - vor allem aber abschalten
kann.
Landschaftsmalerei
Neben den reinen "Postkarten-
Landschaftsgemälden" themati-
siert Fritz Kerzmann in seinen
Bildern zunehmend das Lebens-
umfeld der Menschen. Seine
"Genre-Bilder" vermeiden jede
heroisierend-beschönigende Sicht
auf die Dinge, geben den unge-
schönten Alltag wieder. Der Maler
verzichtet nun auf die sonst üb-
lichen Staffagefiguren.
Die meisten seiner Bilder sind
tier- und menschenleer, stellen
in gewisser Weise (nur) "Relikte
der Landschafts-, Arbeits- und
Wohnbesiedelung" dar und
charakterisieren damit dennoch
sehr eindringlich das jeweilige
"Genre".
Die Verbundenheit des Malers
Fritz Kerzmann mit seinen Bonner
und Godesberger Malerkollegen
- darunter Carl Nonn und Toni
Wolter - zeigt sich unter anderem
darin, dass sie gelegentlich alle
bewußt genau das gleiche Motiv
auf ihre Leinwand bringen.
Jeder in seinem eigenen Malstil,
jeder mit seiner eigenen indivi-
duellen Handschrift. Sie "zitieren"
sich auf diese Weise untereinan-
der. Und tatsächlich hat sowohl
Carl Nonn wie auch Toni Wolter die Zugspitze und den Eibsee von nahezu
der gleichen Stelle aus gemalt. Eine ähnliche Motivreferenzierung ist
übrigens auch beim "Totenmaar /Weinfelder Maar" in der Eifel nachweis-
bar.
1918 Auch die traditionsreiche Städte
des Ostens: Weimar, Jena,
Leipzig, Dresden, Magdeburg,
Erfurt, Eisenach (mit seiner
Wartburg) scheint der Maler
Fritz Kerzmann nach dem 1.
Weltkrieg des öfteren bereist
zu haben. Nachweislich hat er
mit Unterbrechungen 12 Jahre
lang (1916-1928) in Halle an der
Saale Quartier bezogen. Hier
feierte er auch als Sänger große
Erfolge, da er aufgrund seiner
stattlich-mächtigen Gestalt und
seiner wuchtigen Tenor- / Bariton-
stimmlage im wahrsten Sinne des
Wortes "hervorragend" den Hel-
dentenor in Wagners Musik-
dramen verkörpert.
1928 Fritz Kerzmann beschließt seine
Sänger- und Bühnenkarriere in
Halle. Zu seiner Verabschiedung
erscheinen in der örtlichen Presse
verschiedene Artikel, in denen
Fritz Kerzmanns künstlerisches
Wirken in und für die Stadt Halle
gewürdigt wird. So wird berichtet,
dass er als Sänger über 60 ver-
schiedene Rollen in über 800 Auf-
führungen, darunter alleine 24
glanzvolle Erstaufführungen ge-
sungen habe, an die man sich
"auf ewig" erinnern werde.
Neben seiner "Sangeskunst"
bleibt auch seine "Malkunst" nicht
unerwähnt. Tatsächlich waren
Ölbilder - meist Landschafts-
gemälde - aus seiner Hand durch-
aus begehrt. Immer wieder tau-
chen noch heute vereinzelte sei-
ner Ölbilder aus Privatbesitz in
Haushalten dieser Gegenden im
deutschen Kunsthandel auf.
Ateliermalerei (Stillleben- und Genremotive)
1920 Neben seiner Tätigkeit als Landschaftsmaler ist Fritz Kerzmann auch
als Ateliermaler aktiv. Mehrere größere Früchtestillleben bezeugen
seine Kunstfertigkeit als Maler. Mit jedem Bild lernt er dazu. Die beiden
nachfolgenden Bilder sind sich im Sujet sehr ähnlich. Das eine (obere)
ist um 1920, das untere 1922 entstanden. Kleine Unzulänglichkeiten,
die im Bild von 1920 noch auftauchen, sind im Bild von 1922, das ins-
gesamt einen "reiferen" Eindruck macht, getilgt.
Fritz Kerzmann: Vase mit Blumen Fritz Kerzmann: Dahlien (1935)
Sammlung: Renate und Hans van Schewyck Sammlung: Renate und Hans van Schewyck
In den 20-er Jahren wird es zunehmend stiller um den Maler und Sänger
Fritz Kerzmann. In den "Godesberger Heimatblättern" wird sein Name
als Künstler nicht mehr explizit aufgeführt.
1934 Das Ehepaar Kerzmann löst den Haushalt in Obergrainau auf und zieht
nach Bad Godesberg um.
In einem Artikel über Toni Wolter, den Schul- und Jugendfreund
Fritz Kerzmanns, ist erwähnt, dass dieser - als er im Herbst 1920 mit
seiner zweiten Frau Marthe Wolter (geborene Sauer) ein Konzert von
Fritz Kerzmann im Kurhaus von Godesberg besucht - "überaus angetan
und beeindruckt von Fritz Kerzmanns volltöniger Stimme und den
vorgetragenen Schumann-Liedern gewesen sei".
Nach einer anderen Quelle ist Fritz Kerzmann mit Marthe Wolter, die
selbst auch eine ausgebildete Musikpädagogin, Sängerin und Malerin
war, noch einige Male mit "Rheinliedern" in dem Friesdorfer Hotel und
Ausflugslokal "Arndtruhe" aufgetreten. Das Lokal wurde - zusammen
mit einem gesonderten, privaten "Ernst-Moritz-Arndt-Museum" - von
Toni Wolters entfernten Verwandten - der Familie Loevenich - geführt.
Zusammen mit seiner Frau Gerda bewohnt Fritz Kerzmann ein
repräsentatives Haus in der Jahnstrasse 35 (heute Jahnallee 35)
im Villenviertel von Bad Godesberg.
1939 Fritz Kerzmann zählt 67 Jahre, als der 2. Weltkrieg ausbricht. Er erlebt
die anfängliche Euphorie, später die Schrecken des Krieges hautnah
mit. Nur knapp entgeht er dem Tod beim alliierten Luftangriff vom
1. Februar 1945 auf Bad Godesberg. Die "Arndtruhe", der Ort seines
wohl letzten öffentlichen Auftrittes als Sänger, brennt infolge des
Krieges aus und wird später auch nicht mehr wiederaufgebaut.
Das nebenstehende Ölgemälde: "Feldkreuz (bei)
Garmisch" stammt aus dem Jahr 1947. Es ist
möglicherweise die letzte Arbeit - zumindest
die letzte, derzeit bekannte Arbeit mit einem
"alpinen" Motiv aus Fritz Kerzmanns Hand.
1949 Fritz Kerzmann stirbt im Alter von 77 Jahren am
22.03.1949. Er wird kurz danach - am 26.03.
1949 -auf dem Burgfriedhof in Bonn-Bad Godes-
berg beigesetzt. Seine Frau Gertrud überlebt
ihn um 7 Jahre, ehe auch sie an der Seite ihres
Mannes beigesetzt wird.
Abb. rechts: Fritz Kerzmann "Feldkreuz (bei) Garmisch", Sammlung: Renate
und Hans von Schewyck
Sicherlich gehört Fritz Kerzmann heute zur "Generation der ver-
gessenen Bonner Künstler". Seine Spuren sind weitgehend verweht.
Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau
hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.