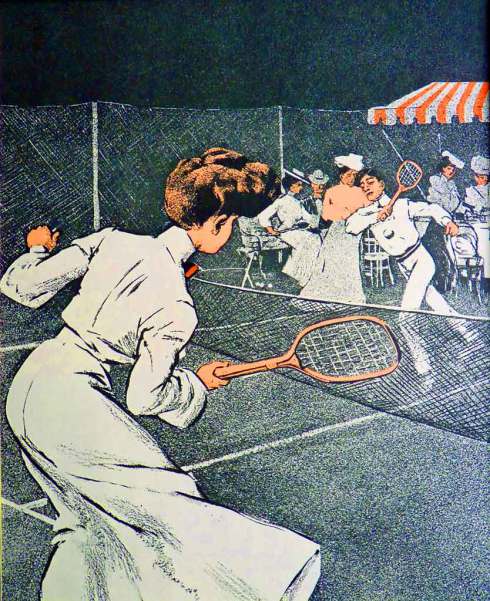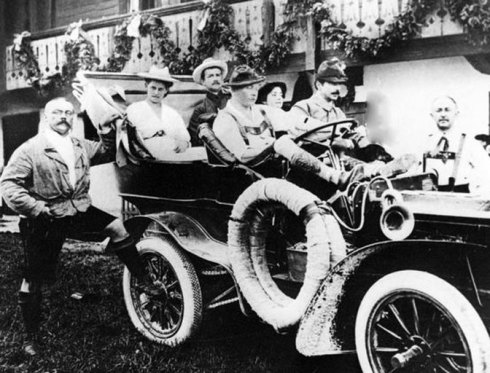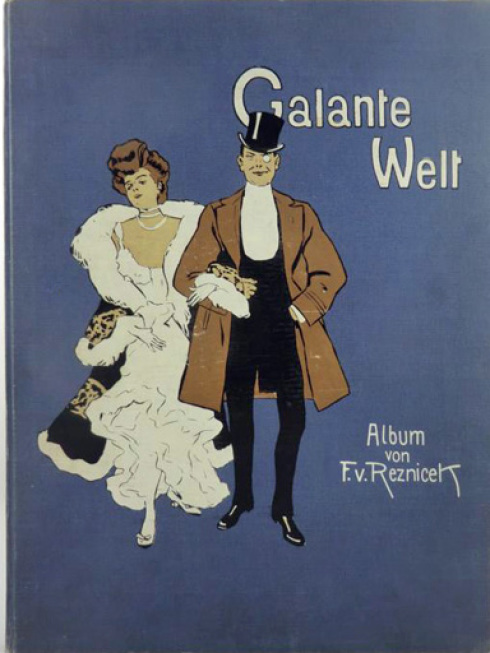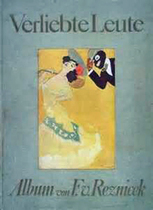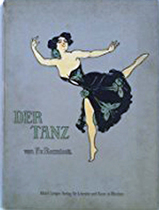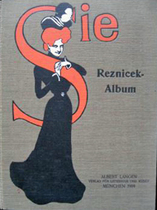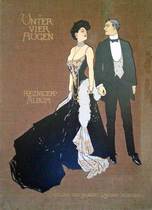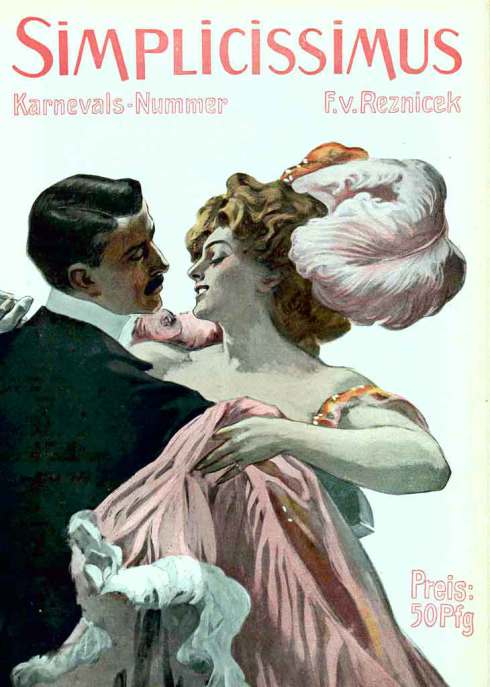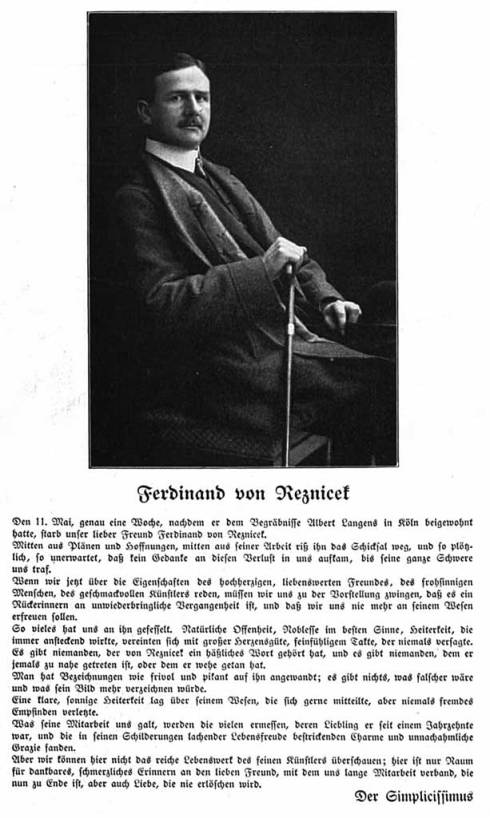Ferdinand von Reznicek (1868-1909)
1868 Am 16.06.1868 erblickt Ferdinand, Freiherr von
Reznicek in Obersievering bei Wien als eines von
drei Kindern des kuk-Generals Joseph Reznicek
das Licht der Welt. Ferdinands Großvater (Josef
Reznicek 1787-1848) war ein bekannter Musiker,
Militärkapellmeister und Komponist von Militär-
märschen.
Ferdinands Vater wurde 1858 vom General zum
österreichischen Feldmarschall befördert und mit
Wirkung vom 1.02.1860 in den Freiherrenstand er-
hoben. Der ersten Ehe des Vaters mit Clarissa,
Gräfin (zu) Ghika, entstammt Ferdinands Halb-
schwester Helene sowie sein Halbbruder Emil
Nikolaus, der später in die Fußstapfen seines Großvaters trat, Musik studierte
und ebenfalls ein erfolgreicher und angesehener Musiker und Komponist
(Opern und Operetten) wurde. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet
Ferdinands Vater die aus einer betuchten Grazer Fabrikantenfamilie stam-
mende Hermine Conrad. Ferdinand erhält von seinen Eltern eine standes-
gemäße, seinem Freiherrenstand entsprechende Erziehung. Er wird im
katholischen Glauben erzogen und innerhalb der Familie zunächst Ferdinand
Franz, später nur noch Franz, gerufen.
1874 Ferdinand wird in die katholische Volksschule in Sievering eingeschult. Von
dort wechselt er 1878/79 auf eine weiterführende Kadettenschule nach Wien.
Schon früh lernt der Junge dort exerzieren, reiten und fechten. Auf Drängen
des Vaters soll er - ganz der Familientradition entsprechend - eine militärische
Laufbahn als Kavallerieoffizier einschlagen. Allerdings scheint ihm der
Mix aus schulischem Lernen und militärischem Drill in der Kadettenschule
nicht besonders zu liegen. Irgendwie gewinnt er innerlich Abstand. Ihm
geht die "staatstragende Funktion des Militärs" auf, einer nicht nur in
Österreich überaus angesehenen Gesellschaftsschicht und eines poli-
tischen Milieus, als deren Vertreter er sich - ob er es will oder nicht - von
seiner Familie her zugeordnet fühlt.
Ferdinand "muckt" zwar nicht auf (zumindet nicht aktenkundig), nutzt aber
seine Zeit an der Kadettenschule, um seine bis dahin noch weitgehend
brachliegenden kreativ-künstlerischen Ambitionen systematisch weiterzu-
entwickeln. Er beginnt. "analytisch" zu zeichnen und lernt, mit "schnellem
Strich" das Wesentliche und Charakteristische einer Situation zu erfassen.
Schon bald merkt Ferdinand, dass er professionelle Anleitung benötigt, um
seine zweifellos vorhandene zeichnerische Begabung weiter auszubauen.
Da er eine solche Förderung in der Kadettenschule nicht erhalten kann,
orientiert er sich um.
1886 Wien ist zu diesem Zeitpunkt ein Schmelztigel für
neue künstlerische Ansätze in fast allen Diszipli-
nen, von der Architektur über die Bildende Kunst
bis zur Dichtung und zum angewandten Kunstge-
werbe. In dieser Zeit finden unter anderem die-
jenigen Kunstschaffenden in Wien zusammen, die
nach dem Vorbild der englischen "Art's and Crafts -
Bewegung" die später weltberühmten "Wiener
Werkstätten" gründeten. Die von Ferdinand bereits
in dieser Zeit durchaus kritisch gesehene restau-
rativ-konservative Geisteshaltung und das elitär,
klassenbezogene Kulturverständnis der Habsbur-
ger Monarchie, des österreichisch-ungarischen
Adelsstandes und des vermögenden Großbürger-
tums ("Geldadel") bilden die "Zutaten" zu einem
spezifisch österreichischen "Aufbruch in die Moderne".
Fin de Siecle
In der französischen Zeitschrtift "Le Decadent" erscheint ein Artikel, der das
spezifische Lebensgefühl jener Zeit beschreibt: Irgendwie wird man sich in
den gesellschaftlich relevanten (kulturtragenden) Kreisen bewußt, dass die
Epoche des Ancien Regime mit der Vorherrschaft des Adels endgültig vor
dem Aus steht. Die zunehmend Fahrt aufnehmende Industrialisierung und
die Gewerbefreiheit verändern die sozialen Strukturen und das Selbstbe-
wußtsein im "gemeinen Volk" grundlegend. Die Kirchen ziehen sich mehr
und mehr auf einen ethisch-moralischen Verhaltenskodex mit Betonung
der persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Gläubigen für sein Handeln
zurück. Sie verlieren zunehmend ihren staatstragenden Einfluß und bieten,
da sie sich von ihren christlichen Grundwerten her politisch nicht "outen"
wollen, keine wirkliche Alternative zum aufkommenden Nationalismus.
Die Stimmung im Volk schwankt zwischen Zukunftseuphorie und gleich-
zeitiger Zukunftsangst. Die latente Furcht vor Regression erzeugt eine
gewisse Endzeitstimmung, erzeugt Lebensüberdruss, Weltschmerz und das
Gefühl von Instabilität und Vergänglichkeit. Dies alles versucht man zu
"übertünchen": Leichtlebigkeit, Frivolität und ein "guter Schuß Dekadenz"
- wohl Ausdruck und Gegenpart der Krisenerscheinungen und der Ver-
änderungsangst, werden in den "Salons des Fin de Siecle" gepflegt. Es
wird zunehmend in, "Dekadenz" zu zeigen und den kulturellen Verfall zum
Objekt einer neuen künstlerischen Bewegung ("Dekadentismus") zu
machen. Eine Subkultur entsteht, die bewußt zur enorm anwachsenden
Militarisierung und dem begleitenden "Hurra-Patriotismus" kontrastiert
und im weiteren alle bis dahin gültigen ethisch-moralische, politische und
gesellschaftlich-soziale Konventionen in Frage stellt.
Die "Kunstfiguren" des Bohemien, des Dandys, des
Snobs und der "Femme fatale" entstehen. Auch
Ferdinand von Reznicek springt auf den "Zug der
Zeit" auf. Er beginnt schon in Wien, seine analy-
tischen "Situationszeichnungen" den einschlägigen
Druckverlagen anzubieten. Seine Bemühungen zei-
gen Erfolg. Unter anderem druckt die satirische
Zeitschrift "Kikeriki" einige seiner "Beobachtungen
aus der vornehm-mondänen (Halb-)Welt der Wiener
Salons" ab. Die Zeitschrift Kikeriki (1861-1933) ver-
stand sich als "humoristisch politisches Volksblatt"
(Untertitel) und war damals Vorbild für eine ganze
Reihe ähnlicher Wochen- und Monatsjournale im
deutschsprachigen Raum. Ferdinand von Reznicek
sammelt bei Kikeriki seine ersten Redaktions-und Editionserfahrungen. Die
Arbeit prägt ihn. Fortan sieht er in der zeichnerisch auf den Punkt gebrachten
Gesellschaftssatire sein spezielles Betätigungsfeld.
Der Wiener "Jugend"stil
Stilistisch sind es zunächst sicherlich die "Importe" aktueller künstlerischer
Strömungen aus Frankreich (Art Nouveau), Italien (Art Liberty), Großbritan-
nien (Art's and Crafts-Bewegung) sowie des nach der Zeitschrift Jugend
benannten "Jugendstils" aus Deutschland - hier vor allem aus München - die
unter den Künstlern Wiens einen "unbändigen Veränderungswillen" wach-
rufen. Der künstlerische Historismus, der - getragen durch die Monarchie -
seine feste Verankerung in der gehobenen Gesellschaftsschicht hat, hat
ausgedient! Etwas Neues, etwas Moderneres muß her.
Die spezifische "Wiener Melanche" dafür ist angerichtet: Gustav Klimt und
Egon Schiele (als Maler), Josef Maria Olbrich (als Architekt) und Hermann
Behr (als Dichter und Poet) werden zu wesentlichen Aushängeschildern der
sich zunehmend entwickelnden "Wiener Sezession", die allerdings erst 1903
formal gegründet wird.
(Die "Wiener Sezession" wird heute kunsthistorisch-stilistisch als eigene
Ausprägung eines österreichischen Jugendstils angesehen).
1887 Der 19-jährige Ferdinand von Reznicek nimmt in
Wien (privaten) Zeichenunterricht bei Julius Victor
Berger (1850-1902), einem Wiener Genre-Maler,
der ab 1881 auch an der renommierten Wiener
Kunstgewerbeschule des k.k. Österreichischen
Museums für Kunst und Industrie als Professor un-
terrichtet. Julius Berger empfiehlt dem jungen
Freiherren Ferdinand von Reznicek, sich "frischen
Wind" um die Ohren blasen zu lassen und eine Reise
nach Paris zu unternehmen. Dort könne er sich mit
der "Belle Epoque" und dem plakativ-grafischen Stil
der neu aufkommenden französischen "Art Nouveau"
auseinanderzusetzen. Möglicherweise gibt er ihm
auch die Adresse von Alphonse Mucha weiter, der im
selben Jahr - unterstützt von dessen Mäzen, dem
kunstsinnigen Wiener Grafen Khuen von Belasy, zu
Studienzwecken in Paris weilt und dort ein eigenes
Künstleratelier einrichtet. Graf Khuen von Belasy ist
mit der Familie Reznicek durch gesellschaftliche Kon-
takte in Wien verbunden. In Belasys Wiener Stadt-
palais wurden mehrfach Konzerte mit Kompositionen
der Rezniceks gegeben, die diese in einzelnen Fällen
auch selbst dirigierten. Ob sich Ferdinand, Freiherr
von Reznicek und Alphonse Mucha jemals persönlich begegnet sind, ist wahr-
scheinlich, bisher aber nicht eindeutig belegt. Viele Indizien sprechen aller-
dings dafür, da Ferdinand von Reznicek später eigene Studienzeichnungen
und Entwurfsskizzen von Jugendstil-Schönheiten anfertigt, die bis in's Detail
dem damaligen "Style Mucha" entsprechen und im übrigen auch ähnliche
inhaltlich-allegorische Bildelemente aufnehmen, die auch Mucha als Attribute
junger Frauen in seiner Portraitmalerei benutzte.
1888 Anlässlich einer weiteren Bildungsreise nach München, sieht sich Ferdinand
von Reznicek an der "Königlichen Akademie der Bildenden Künste" um. Die
Akademie hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf ("Münchner Schule") auf-
zuweisen, befindet sich aber bereits im Umbruch: Auch hier sind künstle-
rische Spaltungstendenzen zu beobachtern. Unter den Studenten ist die Unzu-
friedenheit mit dem festgefahrenen, durch die Müncher "Malerfürsten" (Franz
von Defregger, Franz von Stuck, Franz von Lenbach, Wilhelm von Kaulbach,
Karl Theodor von Piloty etc.) gegründeten und strikt hochgehaltenen "Akade-
mischen Historismus" deutlich spürbar.
1889 Am 21.10.1889 schreibt sich Ferdinand - damals 21
Jahre alt - unter der Matrikelnummer 601 in die
"Naturklasse" der Münchner Kunstakademie ein.
Seine Klasse wird von Paul Höcker (1854 - 1910) be-
treut. Paul Höcker war zunächst (mit Unterbrechun-
gen in Berlin) als akademischer Zeichenlehrer an
der königlichen Kunstakademie tätig. Ab 1988 wand-
te er sich verstärkt der Lichtwirkung in der Freiluft-
malerei zu und bereitete damit den Weg zum späte-
ren Impressionismus in der Landschaftsmalerei vor.
Ende 1890 wurde er zum Professor auf den vakan-
ten Lehrstuhl von Friedrich August von Kaulbach an
der Königlichen Kunstakademie München berufen.
Das hinderte Höcker aber nicht daran, im Folgejahr
1891 - zusammen mit knapp 90 anderen Künstler-
kollegen - die "oppositionelle" Münchner Sezession zu gründen, als Vorstand
zu kandidieren und sich zum Schriftführer dieses auf Anhieb wichtigsten und
einflußreichsten Münchner Künstlervereins wählen zu lassen.
Paul Höcker ist in München "bestens verdrahtet". Sein Wort hat bei nahezu
allen Münchner Kunstschaffenden Gewicht und seine Personalempfehlungen,
mit denen er seine Studenten "in Brot und Arbeit" bringt, erweisen sich stets
als Volltreffer.
Ferdinand von Reznicek verlegt seinen Wonsitz von Wien nach München. Er
findet sich schnell in München ein und sammelt einen weitgefächerten Freun-
des- und Bekanntenkreis um sich herum. Seine Wohnung (mit Atelier) befin-
det sich im 3. Stock eines Hauses in der Franz-Joseph-Straße 18 in München.
Er wohnt zwar alleine, jedoch keineswegs asketisch. Um die Damenbesuche,
die der junge, charmante Freiherr in seiner Atelierwohnung empfängt, ranken
sich Legenden. Direkt über ihm im 4. Stock haben zwei Freunde - sein Stu-
dienkollege Rudolf Thöny (1866-1950) und dessen Freund, der Zeichner und
Illustrator Rudolf Wilke (1873 - 1908) - deutlich bescheidenere Unterkünfte.
Das Trio ist abends meist gemeinsam unterwegs. Man genießt die studen-
tische Freiheit, das Münchner (Nacht-)Leben (und die Liebe) in vollen Zügen.
Um zumindest etwas unabhängiger von der finanziellen "Apanage" des
Elternhauses zu sein (und vielleicht auch, um bezüglich seines relativ frei-
zügen Lebensstiles nicht stängig Rechenschaft gegenüber den Eltern ablegen
zu müssen), arbeitet Ferdinand neben seinem Studium freiberuflich als
Grafiker für den jungen Münchner Buchverlag des aus der Kölner Zucker-
produzenten-Dynastie Langen & Söhne stammenden Albert Langen.
Wahrscheinlich machte Paul Höcker den aus Paris
zunächst nach Dresden und von dort nach München
zugezogenen Albert Langen (1869-1909) auf seine
talentierten Zeichenstudenten aufmerksam, denn
auch Ferdinands Freunde Eduard Thöny und Rudolf
Wilke arbeiten für dessen Verlag. Es entstehen Pla-
kate, Einladungskarten, Werbeanzeigen, vor allem
aber Bucheinbände und Illustrationen. Innerhalb des
Langen-Verlages betreut Ferdinand die "Kleine Bib-
liothek Langen", eine Buchreihe, die sich zur Aufga-
be gestellt hat, die Werke junger aufstrebender
Autoren bekannt zu machen. Seine ausgezeichneten
französischen Sprachkenntnisse und das geschliffene
Auftreten helfen dem Kunststudenten Ferdinand von
Reznicek, Kontakt zu den von Albert Langen wäh-
rend dessen Volontärszeit in Paris an den Verlag ge-
bundenen französischen Autoren zu halten und sie während ihrer Aufenthalte
in München persönlich zu betreuen. Daraus entstehen eine Reihe enger
Freundschaften, so unter anderem mit dem angesehenen französischen
Modeautor Marcel Prevorst. Bei Albert Langen hat "FF" - der "flotte Franz"
wie man Ferdinand im Verlag tituliert - schon bald ein Stein im Brett.
1895 Ferdinand von Rezniceks akademisches Kunststudium endet wohl per
schleichenden Übergang in eine mehr oder minder "auskömmliche" Fest-
einstellung als redaktioneller Mitarbeiter im Albert-Langen Verlag. Ein genauer
Exmatrikulationstermin ist jedenfalls nicht verzeichnet und auch ein regulärer
Studienabschluß, im Allgemeinen dokumentiert durch die Überreichung des
"Akademiebriefes" ist nicht dokumentiert.
Simplicissimus
1896 Zusammen mit dem deutschen Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler
Frank Wedekind (1864-1918) konzipiert Albert Langen nach dem Vorbild
der französischen Zeitschrift "Gil Blas Illustre" eine illustrierte Literaturrevue,
die vierzehntägig in deutscher Sprache erscheinen soll. Ihr Ziel ist es, neue
literarische Texte vorzustellen und diese durch einfühlsame - oder auch
reißerisch-provozierende Illustrationen dem Publikum näherzubringen.
Ferdinand von Reznicek ist von Anfang an ausführend an dem Projekt be-
teiligt. Albert Langen wählt für seine Literaturrevue den Namen:
"Simplicissimus" Am 4.4.1896 erscheint die Erstausgabe. Zurückzuführen auf
den Einfluß des Gesellschafts-Dramatikers Frank Wedekind wandelt sich mit
der Aufnahme sozialkritischer Texte rasch und nachhaltig der Zuschnitt des
Blattes. Die Literaturrevue wird zum Satiremagazin Simplicissimus.
Ferdinand von Rezniceks Erfahrungen mit dem Wiener Satiremagazin Kikeriki
zahlen sich nun aus. Er erhält seine Festeinstellung und avanciert alsbald zu
einem der wichtigsten Zeichner des Magazins, dessen Publikumserfolg zu
einem nicht unerheblichen Maße auf seine gezeichneten "Beobachtungen" in
den Salons der "feinen (Münchner) Gesellschaft", in Boudoirs, Separees,
Nachtbars, in Schlafzimmern, Theater- und Ballsäälen zurückzuführen ist.
Vielleicht mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Ferdinand gerne einen
"guten Schuß Erotik" in seine Zeichnungen "verpackte". Nichts richtig Nacktes,
aber dennoch viel situationsbedingt Anregendes, eben Frivoles und Dekaden-
tes. Ferdinand thematisierte gerne Paarbeziehungen, vor allem Frauen aller
Gesellschaftsschichten, die durch ihre Bekleidung, durch ihr situations-
spezifisches Verhalten und die liebevoll ausgearbeiteten Interieurdetails ein
beredetes - weil pointiert überzeichnetes - Abbild der jeweiligen Lebens-
verhältnisse der "upper class" wiedergeben. Die gezeichneten "Beobach-
tungen" erhielten häufig erst ihre bissig-satirische Würze durch die Bildunter-
schriften, die in aller Regel durch die Textredaktion nach Vorlage der Zeich-
nungen spezifisch dazuerfunden wurden und vielfach eine boshafte Kritik an
den herrschenden Usancen in der vermeindlich "guten" Gesellschaft, vor
allem natürlich des (noch) priviligierten Adels sowie des Miltärs beinhalteten.
Später wurden auch die "Neureichen" mit ihrer Sucht, vornehm und mondän
zu erscheinen, auf's Korn genommen.
1900 Ferdinand (Franz) Freiherr von Reznicek lernt seine
spätere Frau Anni (oder Anny) kennen. Sie ist bür-
gerlicher Abstammung und soll aus einer Kunsthand-
werkerfamilie stammen. Eine ausgesprochen schöne
Frau, deren damenhafte Erscheinung Ferdinand fort-
an in vielen seiner Zeichnungen wiedergibt. Sie steht
ihm für situationsbedingte Haltungsstudien Modell.
Ihre nach der damaligen Mode aufgesteckt-hochge-
bundene Haarpracht, die Ferdinand mit liebevoller
Akuratesse zu Papier bringt, ist Vorbild für viele
junge Frauen des "Jugendstils".
Zu welchem Termin das Paar heiratet, ist nicht über-
liefert. Wahrscheinlich, wie die Gelatineabzüge von
einigen Münchner Photo-Studios vermuten lassen,
zwischen 1902 und 1903. Die Ehe bleibt kinderlos.
Ferdinand (Franz) Freiherr von Reznicek und seine Frau Anny von Reznicek
Reznicek-Zeichnung aus der Reihe: "Deutscher Sport"
Ferdinands "Zeichnungen aus der mondänen Welt"
entstehen stets aufgrund eigener, gut vorbereite-
tern Recherchen und Beobachtungen des Künstlers.
Die Anregung zu der Zeichnung "Deutscher Sport"
(siehe oben) erhielt Ferdinand beispielsweise von
seiner angeheirateten Verwandten Paula von
Reznicek, die als Journalistin und Schriftstellerin
tätig war und "nebenbei" große Erfolge als Tennis-
spielerin für sich verbuchen konnte. Sie stand ihm
u.a. für die notwendigen Bewegungsstudien (Arm-
und Handhaltung) Modell. Zudem lieferte sie ihm
Hintergrundsinformationen aus der Welt des Sports.
Paula von Reznicek (geborene Heimann) war später in zweiter Ehe mit dem
Rennfahrer Hans Stuck verheiratet. Ferdinand hatte bereits über die Gebrü-
der Hans und Ernst Neumann, die beide für die Zeitschrift "Jugend" zeichne-
ten, Kontakt zur deutschen Motorsportszene, die um die Jahrhundertwende
zwar noch in der Entwicklung war, aber im gemeinen Volk bereits die Aura
von Rasanz, Hochleistung, technischem Fortschritt und Exklusivität besaß.
Die Motorsportszene war damals ausgesprochen mondän. Sie lebte im We-
sentlichen von mehr oder minder vermögenden "Herrenfahrern", die um
sich herum einen eigenen Kreis von Enthusiasten versammelten und als
Schlüsselkäufer von den Automobilfirmen massiv umworben wurden.
Ernst Neumann war ein umtriebiger "Tausendsassa" in München. Neben
seiner Zeichnertätigkeit für die Zeitschrift "Jugend" konstruierte er die
seinerzeit sehr bekannten und erfolgreichen "Neander-Fahrmaschinen",
fertigte sie in einer eigenen Werkstatt und gründete einen eigenen Rennstall
mit Neander-Motorrädern und Neander-Rennautomobilen.
Unter anderem baute Ernst Neumann in seiner in der Eifel bei Düren gele-
genen Werkstatt für Opel die früheren, raketengetriebenen Opel-Rennwagen
und auch "Auto Union" und "Daimler-Benz" griffen auf sein spezifisches
Konstrukteurswissen beim Aufbau ihrer eigenen Rennwagen zurück.
Es sind solche persönlichen "Jet-Set-Kontakte", die Ferdinand von Rezniceks
Simplicissimus-Zeichnungen so authentisch und lebensecht machen. Zudem
waren alle seine Frauengestalten jeweils nach der neuesten Mode gekleidet.
Ob als Hausherrin oder als Bedienstete, ob als mondäne Dame oder als
Straßenmädchen, ob als brave Gattin oder als ausgehaltene Kurtisane,
immer portraitierte Reznicek seine Modelle in ihrer (mehr oder minder)
schönen Weiblichkeit, zu der - der damaligen, eigentlich recht prüden Zeit
entsprechend - nun auch körperbetont eng anliegende Bekleidung, geschnür-
te Mieder, Wespentailien, aufwändige Hüte und Frisuren gehörten.
Tatsächlich wurde der Simplicissimus - eben wegen seiner pikanten "Mode-
zeichnungen" - auch als "trendsetzendes Unterhaltungsmagazin" hoch ge-
schätzt.
Reznicek - Alben
Mit der Zeit gab der Albert-Langen Verlag eine Sammlung der besten
Simplicissimus-Zeichnungen von Ferdinand von Reznicek in Form farbiger
"Modealben" heraus. Sie fanden reißenden Absatz, wurden mehrfach in
Nachauflagen nachgedruckt und gelten heute als gesuchte Sammelstücke,
die exemplarisch den "Geist" der damaligen Zeit wiedergeben.
Ferdinand von Reznicek: Zeichnungsalben, Albert-Langen Verlag, München
oben links: Verliebte Leute (1904) oben rechts: Der Tanz (1907)
unten links: Sie (1908) unten rechts: Unter vier Augen (1909)
Wer den Simplicissimus las, gab damit auch seiner "oppositionellen" Ein-
stellung zu den herrschenden (gesellschafts-)politischen Verhältnissen Aus-
druck. Ein Faktum, dass durchaus zur Modernität, zu einer beflissendlich
zur Schau gestellten mondänen Dekadenz und zum ausgeprägten Fatalis-
mus in Offiziers- und Adelskreisen um die Jahrhundertwende gehörte.
Ferdinand Freiherr von Reznicek war von 1896 bis zu seinem Tod 1909
ununterbrochen beim Simplicissimus beschäftigt. Von Anfang an war er
einer der prägendsten Zeichner des Blattes. Der Gründer und Inhaber des
Verlages - Albert Langen - trug seinem inzwischen auch zum guten persön-
lichen Freund avancierten Chefzeichner die Mitherausgeberschaft am
Simplicissimus an. Ferdinand nahm diese Herausforderung dankend an,
behielt sich aber vor, darüber hinaus noch weitere freiberufliche "Engage-
ments" bei verschiedenen Münchner Zeitschriften - unter anderem bei der
teilweise konkurrierenden Münchner Zeitschrift: "Die Jugend" - anzunehmen.
Er wollte um jeden Preis vermeiden, zuviel "Stallgeruch" beim Simplicissimus
zu erlangen und dadurch in seiner Zeichnungsstilistik auf ewig festgelegt zu
sein. Tatsächlich hat er es geschafft, auch für andere Münchener Publika-
tionen - wie beispielsweise die "Fliegenden Blätter" und andere gesellschafts-
satirische Wochen- und Monatsmagazine prägend zu werden. Vielleicht nicht
ganz so, wie er den Simplicissimus in seiner inhaltlichen Ausrichtung als
interlektuelles literisches Satiremagazin mitgeprägt hat, wohl aber in der
Durchsetzung eines Zeichnungs- und Darstellungsstils, den man heute in
Deutschland - in Analogie zum Namen des einschlägigen Münchner Ver-
öffentlichungsorgans - als "Jugendstil" bezeichnet. Ferdinand Freiherr von
Reznicek war als bildender Künstler überaus produktiv. Im Laufe seines
Berufslebens hat er alleine für den Simplicissimus weit über 1000 Druck-
vorlagen, darunter etliche Titelblätter gezeichnet.
Zusammenstellung von Simplicissimus-Titelblättern
(gezeichnet von Ferdinand von Reznicek)
(Zur Vergrößerung bitte auf die Abbildungen klicken)
1906 Im Laufe des Jahres 1906 - Ferdinand ist gerade 38 Jahre alt geworden, wird
bei ihm eine chronische Magen-Darmentzündung diagnostiziert, aus der sich in
den folgenden Jahren ein Darmkrebs entwickelt. Der Künstler sieht sich
gezwungen, seine Arbeit im Albert-Langen-Verlag deutlich einzuschränken.
Es ist ihm allerdings eine Herzensangelegenheit, die jährlichen Sonderaus-
gaben des "Simpl", wie das Magazin im internen Jargon genannt wird,
weiterhin federführend zu gestalten. Vor allem die Sonderausgaben zum
Karneval, respektive zum "Münchner Fasching", der für die "Upper-Class"
stets mit mondän-eleganten Bällen und für das gemeine Volk stets mit hand-
fest-zünftiger Kneipen- und Bierzelt-Unterhaltung verbunden ist, erreichen
quer durch alle Gesellschaftsschichten hohe Auflagen. Ferdinand läßt diese
Gegensätze "lustvoll" aufeinandertreffen.
"Nichts ist emotional so ansteckend, wie gesellschaftlicher Voyeurismus und
die Freude, selbst zum Kreis der "Erlauchten" zu gehören, respektive der
unverhohlene Neid, wenn man selbst nicht mitmachen darf und zusehen
muß, wie andere sich vergnügen."
Simplicissimus-Sonderausgaben zur Münchner Karnevals-/Faschingszeit
1909 Am 30.04.1909 verstirbt überrraschend Ferdinands Freund und Förderer,
der Verleger Albert Langen im Alter von 40 Jahren in München. Dieser hatte
zuvor Ferdinand zum künstlerischen Leiter des Gesamtverlages, verantwort-
lich für das Erscheinungsbild des literarischen Buchprogramms ebenso wie für
die verschiedenen Periodikas des Hauses - vor allem natürlich für das
Satiremagazin Simplicissimus - bestellt. Ferdinand wollte unter allen Um-
ständen dem Wunsch seines Freundes gerecht werden. Er plante, sich
bezüglich seines chronischen Darmleidens schnellstmöglich in einer Münchner
Klinik operieren zu lassen. Noch drei Tage, bevor er sich in die Klinik begab,
"werkelte" er in seinem Verlagsbüro und stellte in Nachtarbeit die letzten drei
Zeichnungen für die anstehenden Ausgaben des Simplicissimus her.
Ferdinand von Rezniceks letzte drei Zeichnungen für den Simlicissimus wurden später posthum veröffentlicht (Zur Vergrößerung bitte auf die Abbildungen klicken).
11.05. Die Operation verlief leider nicht reibungslos. Ferdinand (Franz) Freiherr von
1909 Reznicek erlitt am 11.05.1909 - knapp zwei Wochen nach dem Tod seines
Freundes Albert Langen - wohl infolge der Darmoperation - einen Blutsturz
und verstarb kurz vor seinem 41. Geburtstag.
Zur Navigation bitte zum Seitenanfang zurückkehren und die nebenstehende (grau
hinterlegte) Kapitelanwahl benutzen oder klicken Sie die unterstrichenen Stichworte in den Texten an.